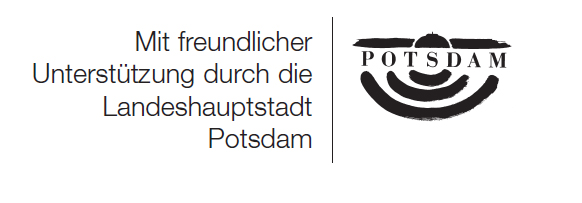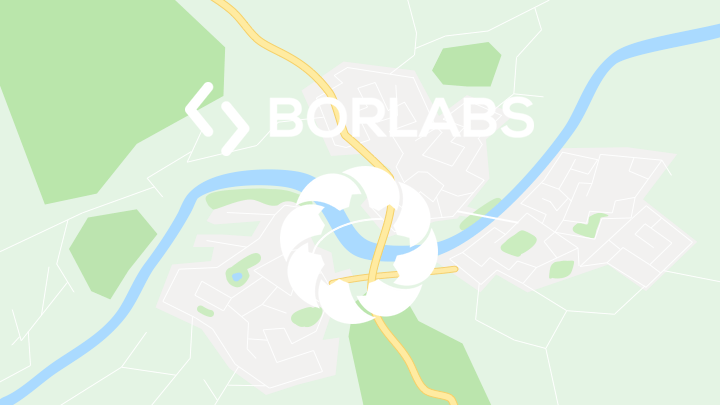30. Juni 2023
ab 18.00 Uhr
Grundschule Hanna von Pestalozza
Groß Glienicke
Hechtsprung 14 - 16
Filme und ihre Zeit präsentiert...
... die 2017 digital restaurierte Originalfassung des mit einem immensen äußeren Aufwand produzierten Historienfilm der DEFA zum Leben und Wirken des protestantischen Geistlichen und Bauernführers Thomas Müntzer.
Regie: Martin Hellberg
131 Min, Farbe (restaurierte Fassung)
DEFA-Studio für Spielfilme, 1955-1956
Premiere: 17.05.1956
Drehbuch: Martin Hellberg, Horst Reinicke und Friedrich Wolf
Musik: Ernst Roters
Kamera: Götz Neumann:
Schnitt: Lieselotte Johl
Darsteller: u.a.
Wolfgang Stumpf (Thomas Müntzer)
Margarete Taudte (Ottilie von Gersen)
Wolf Kaiser (Schwabenhannes)
Martin Flörchinger (Heinrich Pfeiffer)
Wolfgang A. Kaehler (Markus Stübner)
Heinrich Gies (Hans Buss)
Ruth Maria Kubitschek (Bärbel Buss, seine Schwester)
Albert Garbe (Bauer Barthel)
Maly Delschaft (seine Frau)
Hans-Joachim Büttner (Veit, ein Bergknappe)
Rolf Ludwig (Spatz, Valentin)
Steffie Spira (vollbusige Nonne)
Ulrich Thein (Student)
Hannjo Hasse (Fürst)
Willi Schwabe (Schmaler, kleiner Höfling)
Agnes Kraus (Hofdame)
und 190 weitere namentlich genannte Schauspielerinnen und Schauspieler sowie über 5.000 Komparsen
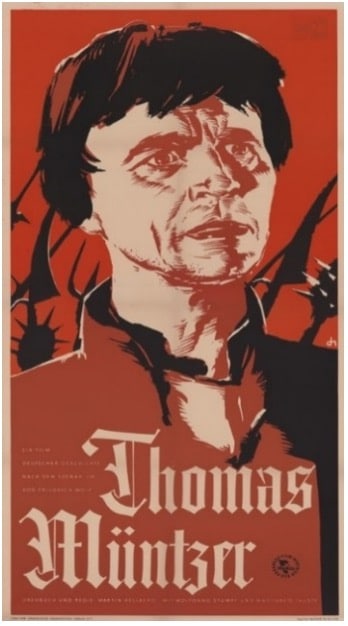
© DEFA-Stiftung / Bert Heller
Handlung
Der junge Thomas Müntzer 1) kommt 1523 mit seiner Frau Ottilie ins thüringische Allstedt, wo er eine Pfarrstelle antreten soll. Als Anhänger Luthers sieht er in der Bibel nicht nur Ansätze zu geistlichen, sondern auch zu weltlichen Reformen - und er ist bereit, sich gegenüber der Obrigkeit auch mit Gewalt zur Wehr zur setzen, um die Situation der Bauern zu verbessern. Er unterstützt den Widerstand der Bauern gegen die hohen Abgaben und stellt sich bewusst gegen die Fürsten, sodass er nach Süddeutschland fliehen muss. Dort schließt er sich den aufständischen Bauern an, geht aber nach einigen Monaten zurück nach Thüringen. 1525 bildet er gemeinsam mit Heinrich Pfeiffer in Mühlhausen das Zentrum des thüringischen Bauernaufstandes, dessen Erfolg allerdings darunter leidet, dass Bauern und Handwerker nicht imstande scheinen, an einem Strang zu ziehen. In Frankenhausen wird er zum Anführer eines Bauernheeres, das sich in einer Schlacht den Fürsten stellt, aber vernichtend geschlagen wird. Müntzer wird festgenommen und für seine aufrührerischen Taten zum Tod durch Enthaupten verurteilt.




Fotos: © DEFA-Stiftung / Manfred Klawikowski
Hier kann der komplette DEFA-Trailer bei YouTube angesehen werden:
Produktion und Wirkung
Der Film war mit einem Budget von 4 Millionen Mark eine der teuersten DEFA-Produktionen ihrer Zeit und nach den beiden Thälmann-Filmen ("Sohn seiner Klasse" von 1954 und "Führer seiner Klasse" von 1955) die dritte Großproduktion der DDR mit einem eindeutigen gesellschaftspolitischen Auftrag: Er sollte "Ursache, ... Verlauf und ... gewaltige historische Bedeutung der ersten Klassenschlacht zwischen Unterdrückten und Unterdrückern in Deutschland klarer, wissenschaftlicher und überzeugender" 2) zeigen und damit ein neues, sozialistisches Geschichtsbild vermitteln.
Gleichzeitig war der Film ausdrücklich auch mit Blick auf die Bundesrepublik konzipiert worden, um "im Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands" 3) auch im Westen erzieherisch wirken zu können. Viele Szenen der ursprünglichen Fassung zeigen diese Ausrichtung, beispielsweise wenn davon die Rede ist, dass der "revolutionäre Funke" aus Thüringen und Sachsen-Anhalt zu "unseren Brüdern am Main und Rhein" überspringen müsse.
Eigentlich war es unter diesen Voraussetzungen kein Wunder, dass "Thomas Müntzer - Ein Film deutscher Geschichte" in der Bundesrepublik sehr kritisch aufgenommen wurde 4) und nach einer Entscheidung des "Interministeriellen Ausschusses für Ost/West-Filmfragen" 5) für einige Jahre nicht öffentlich gezeigt werden durfte.
1974 beschloss das DDR-Kultusministerium, den Film anlässlich des 450. Jahrestages des Bauernkrieges erneut in die Kinos bzw. ins Fernsehen zu bringen. Wegen der veränderten politischen Situation nach dem Mauerbau - die DDR wollte vom Gedanken der deutschen Einheit nichts mehr wissen - sollten jetzt alle Szenen herausgeschnitten werden, die einen gesamtdeutschen Bezug hatten. Regisseur Martin Hellberg musste seinen Film um deshalb fast ein Viertel kürzen, bevor er wieder gezeigt werden durfte.
Zum Reformationsjubiläum 2017 hat die DEFA-Stiftung die Ursprungsfassung aufwändig rekonstruiert. Dabei hatten es die Restauratoren nicht nur mit den politischen Schnittauflagen zu tun, sondern auch mit einem unvollständigen Originalnegativ, das in einem komplizierten Verfahren mithilfe von Duplikatnegativen digital ergänzt werden musste.
Präsentation am 30. Juni 2023
Grundschule Hanna von Pestalozza
14476 Potsdam - OT Groß Glienicke
Hechtsprung 14 - 16
19.00 Uhr Filmstart (Moderation: Holger Fahrland)

Prof. Dr. Thomas Naumann
Foto: © DESY / Wikipedia
Anmerkungen:
[1]
In den 50er Jahren wurde in der DDR die Schreibweise "Münzer" bevorzugt, wahrscheinlich weil der sowjetische Historiker Moissej M. Smirin diese Version in seinem Buch "Die Volksreformation des Thomas Münzer und der Große Bauernkrieg" (dt. 1952) verwandte und weil Smirin durch eine Stellungnahme zum Szenarium persönlich in die Vorbereitungen eingebunden war. Bereits das Filmprogramm von 1956 trägt allerdings den historisch korrekteren Titel "Thomas Müntzer" (vgl. Rotraud Simons, "Der Pfarrer bleibt vom Bild her problematisch." Christliche Filminhalte in der DDR. Thomas Münzer. Berliner Institut für vergleichende Staat-Kirche-Forschung 2005, S. 1 Anm. 1. Reiter Publikationen - ebooks - Filmliste - Thomas Münzer). Die äußerst positive Stellungnahme Smirins zum Szenarium ist als Dokument 5 bei Simons abgedruckt (ebd., S. 26 ff.).
[2]
Zulassungsprotokoll Nr. 157/56 A v. 11. April 1956. BArch/FA O. 162 (zit. nach Simons a.a.O., S. 42. Hervorhebung im Original). In diesem Sinne hatte DEFA-Direktor Hans Rodenberg schon 1953 bei der Besprechung des Filmexposés ausdrücklich betont, dass der Film "für breite Massen unseres Volkes geschichtsbildend ... im tiefsten Sinne des Wortes" sein sollte und ergänzt: "Die Massen müssen das für die geschichtliche Wahrheit nehmen." (Protokoll der Sitzung des Rates beim Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Filmwesen am 01.07.1953. BArch DR 1/4581. Zit. nach Simons, a.a.O., S. 38).
[3]
Protokoll der Informationsvorführung des Films am 28.02.1956. BArch DR 1/4771 (zit. nach Simons, a.a.O., S. 38). Diese gesamtdeutsche Perspektive wird in allen offiziellen Diskussionen über den Film in den 50er Jahren immer wieder betont.
[4]
So schrieb beispielsweise der SPIEGEL am 10.07.1956, der Regisseur habe "den Wiedertäufer-Rebellen, Bilderstürmer und Märtyrer des Bauernkrieges in einen urkommunistischen Ahnherrn des Walter Ulbricht umfrisiert" (Quelle hier); der "filmdienst" bezeichnete die Wirkung des Films als "in seiner Geschichtsinterpretation oberflächlich und tendenziös" (Quelle hier). Zudem wurden ihm diverse historische Fehler vorgeworfen, insbesondere im Hinblick auf die fast vollständige Aussparung von Martin Luthers Leben und Wirken, auf die Darstellung der Niederlage der Bauern in der Schlacht von Frankenhausen als Ergebnis von Verrat und Sabotage (tatsächlich waren die militärisch schlecht gerüsteten Bauern nicht in der Lage, den Fürsten etwas Adäquates entgegenzusetzen) und der Glorifizierung von Müntzer als standfesten Revolutionär, der seine Ansichten auch unter Folter und auf dem Schafott noch bekräftigt habe (tatsächlich soll er sie widerrufen haben).
[5]
Der "Interministerielle Ausschuss für Ost/West-Filmfragen" war ein vom Bundesinnenministerium initiiertes Gremium, in dem Vertreter verschiedener Ministerien von Dezember 1953 bis Anfang 1967 ohne echte Rechtsgrundlage Filme aus dem Ostblock daraufhin überprüften, ob sie einen negativen Einfluss auf die eigene Bevölkerung ausüben und damit "feindliche Propaganda" sein könnten. In dieser Zeit wurden etwa 3.180 Filme begutachtet (davon 634 DDR-Produktionen), von denen ca. 130 keine Aufführungsgenehmigung erhielten. Von den überprüften Filmen aus der DDR wurden insgesamt 66 nicht und 39 nur mit Auflagen freigegeben; von den 66 gesperrten Filmen erhielten später 24 Filme noch eine Freigabe. "Thomas Müntzer" wurde mit der Begründung verboten, er verherrliche in "geschichtlich anfechtbarer Weise den Bauernkrieg" und sei "in seiner Tendenz hetzerisch". 1965 wurde der Film dann aber ohne weitere Auflagen freigegeben, als der Allgemeine Studentenausschuss der Universität Heidelberg den Film im Rahmen eines Seminars vorführen wollte. (Vgl. Andreas Kötzing: Der Interministerielle Ausschuss und die Zensur von DEFA-Filmen in der Bundesrepublik. Veröffentlicht auf der Website des Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V.)
Mit freundlicher Unterstützung durch